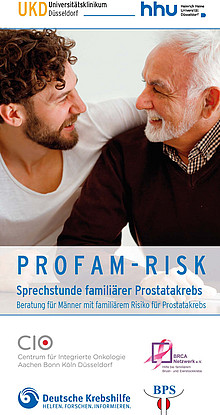Familiäres Risiko für Prostatakrebs
Beratung für Männer mit familiärem Risiko für Prostatakrebs
Prostatakrebs ist weltweit die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Während diese meistens zufällig auftritt, kann das Risiko durch genetisch vererbte Veränderungen (Mutationen) erhöht werden. Je nach individueller familiärer Vorgeschichte haben Männer ein unterschiedlich hohes Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken. Die wichtigsten Anzeichen einer erblichen Risikoerhöhung sind eine Häufung von familiären Erkrankungsfällen von Prostatakrebs bei Männern sowie von Brust – und/oder Eierstockkrebs bei Frauen und ein frühes Erkrankungsalter (unter 60 Jahren). Inzwischen wurden mehrere Gene identifiziert, die bei Mutationen das Prostatakrebsrisiko erhöhen.
Bislang gibt es jedoch für Männer mit familiärer Häufung von Prostatakrebs kaum standardisierte Beratungsangebote. Mit der vorliegenden Studie (gefördert durch die Deutsche Krebshilfe) wird eine spezielle Risikosprechstunde für Ratsuchende durch verschiedene Fachdisziplinen am Universitätsklinikum Düsseldorf (Urologie, Humangenetik, Radiologie, Gynäkologie und Psychoonkologie) angeboten.
Ziele der Sprechstunde

- Genaue Auswertung der Untersuchungsergebnisse
- Informieren über das individuelle Prostatakrebs-Risiko des Interessierten oder von Familienmitgliedern (z.B. Brüder, Söhne)
- Individuelle Empfehlung für Nachfolgeuntersuchungen
- Frühzeitiges Erkennen von möglicherweise auftretendem Krebs auch bei nicht-erkrankten Verwandten
- Risiko-adaptierte Früherkennung bei vorliegender Krebserkrankung
- Bei Hinweisen auf andere vererbbare Erkrankungen:
Empfehlung zu weiteren Früherkennungsuntersuchungen
(z.B. Darmspiegelung) - Besseres Verständnis von relevanten Faktoren für Vererbung
von Prostatakrebs
Prostatakrebs: Wann haben Männer ein familiäres Risiko?
Welche Männer müssen damit rechnen, dass eine erbliche Risikoerhöhung nachgewiesen wird? Welche Folgen ergeben sich daraus? Und was leistet die PROFAM-RISK-Sprechstunde? Klinikdirektor Prof. Dr. Peter Albers und Oberärztin Dr. Jale Lakes stellen die Sprechstunde für Männer mit familiärem Prostatakrebs-Risiko vor.
Beteiligte Projektpartner




Eine Studie des

Leitung des Projekts
Univ.-Prof. Dr. med. Peter Albers, Direktor der Klinik für Urologie, Universitätsklinikum Düsseldorf
Univ.-Prof. Dagmar Wieczorek, Direktorin des Instituts für Humangenetik, Universitätsklinikum Düsseldorf
Dr. André Karger, Klinisches Institut für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Düsseldorf